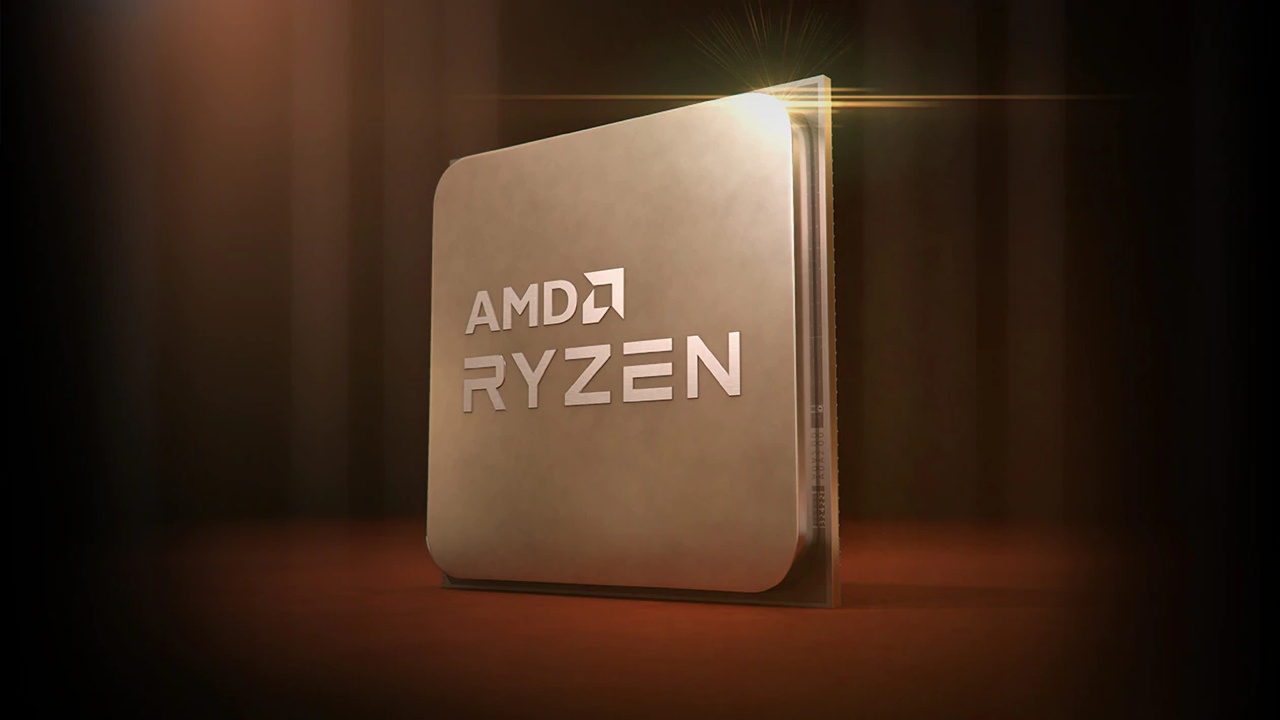Gerichtsurteil: Städte dürfen Verpackungssteuer erheben: Wird To-go-Essen bald teurer?
Seit 2022 zahlen Betriebe in Tübingen Steuern auf Einwegverpackungen. Das Bundesverfassungsgericht hat das für rechtens erklärt. Ziehen andere Städte jetzt nach?

Seit 2022 zahlen Betriebe in Tübingen Steuern auf Einwegverpackungen. Das Bundesverfassungsgericht hat das für rechtens erklärt. Ziehen andere Städte jetzt nach?
Ob Pizzakarton, Pommesschale oder Eisbecher: Wenn sich hungrige Tübinger etwas auf die Hand holen oder Essen zum Mitnehmen bestellen, kostet das extra. Vor drei Jahren hat die Stadt als erste in Deutschland eine Steuer für Einwegverpackungen eingeführt. Seitdem zahlen Unternehmen, die To-go-Kaffeebecher, isolierende Menüboxen und Pappteller an Kunden aushändigen, jeweils 50 Cent – unabhängig davon, aus welchem Material die Verpackungen sind.
Seit Jahresanfang erhebt auch Konstanz eine Einweg-Steuer, Freiburg will im Sommer nachziehen und Heidelberg plant, demnächst eine entsprechende Steuer einzuführen. Bald könnten noch weitere Städte dem Vorbild Tübingens folgen: Das Bundesverfassungsgericht hat vor kurzem bestätigt, dass die Verpackungssteuer rechtens ist (Az. 1 BvR 1726/23). Wird Essen unterwegs bald teurer?
Mit Steuern gegen Vermüllung
Ziel der Einweg-Steuer: Verpackungsmüll reduzieren. „Im öffentlichen Raum waren überall Wegwerfprodukte sichtbar“, sagt Claudia Patzwahl, Projektleiterin bei der Stadt Tübingen. „Sie lagen rund um die Mülleimer, auf Treppen und haben Wiesen und den Neckar verschmutzt.“ Solange das Problem weiterbesteht, soll die Verpackungssteuer den städtischen Haushalt stärken. „Die Steuer finanziert unter anderem das Einsammeln von Müll im öffentlichen Raum und dessen Entsorgung“, erklärt Patzwahl weiter.
Nach drei Jahren Verpackungssteuer bemerkt Tübingen bereits eine positive Entwicklung. Für das erste Jahr habe die Verwaltung knapp über eine Million Euro eingenommen, 2023 spülte sie etwas weniger in die Stadtkasse und für 2024 rechne man noch mit Einnahmen in Höhe von 800.000 Euro. „Langsam zeigt sich eine Lenkungswirkung“, sagt Patzwahl. „Immer mehr Betriebe stellen auf Mehrwegverpackungen um.“
50 Cent für Geschirr, 20 Cent für Besteck
Besteuert wird in Tübingen Einwegmaterial, also Gefäße, Behälter, Geschirr und Besteck, das „für einen Verzehr noch im Verkaufsraum, in der Nähe oder für unterwegs“ gedacht ist, heißt es von Seiten der Stadt. Für Einmal-Verpackungen werden 50 Cent fällig, für Besteck und Strohhalme jeweils 20 Cent. Die Steuer zahlen müssen Gastronomen und Händler, die Getränke oder Mahlzeiten zum unmittelbaren Verzehr in Einwegverpackungen verkaufen. Schalen und Boxen, mit der Restaurants Essensreste verpacken, werden hingegen nicht besteuert. Gleiches gilt für Essen, das Lieferdienste nach Hause oder ins Büro bringen.
Ob die Betriebe wegen der Steuer ihre Preise erhöhen, bleibt jedem Betreiber selbst überlassen. Aber damit die Lenkungswirkung der Steuer eintrete, befürworte die Stadtverwaltung Tübingen es, wenn die Gastronomie die Steuer transparent auf ihre Kundschaft umlege: „Verbraucher können sich dadurch bewusst gegen Einweg und für Mehrweg entscheiden“, sagt Patzwahl.
Gericht bestätigt Steuer
Auch anderen Städten bereitet die Vermüllung durch Take-Away-Essen Probleme. Dass die Verpackungssteuer dagegen eine gangbare Maßnahme darstellen kann, hat das Bundesverfassungsgericht nun bestätigt. Gegen die Tübinger Steuer hatte eine McDonalds-Franchisenehmerin Verfassungsbeschwerde eingelegt. Die Frau argumentierte, die Stadt dürfe eine solche Steuer gar nicht einführen, ihr fehle die nötige Gesetzgebungskompetenz.
NL Die WocheDem widersprachen die Richterinnen und Richter in Karlsruhe: Nach dem Grundgesetz dürfen Gemeinden grundsätzlich „örtliche Verbrauchssteuern“ erheben. Da Speisen und Getränke zum Mitnehmen meist „auf die Schnelle“ im Stadtgebiet verzehrt würden, sei der nötigen „Ortsbezug“ bei der Tübinger Verpackungssteuer gegeben.
Andere Städte könnten folgen
Künftig könnten also immer mehr Städte dem Tübinger Beispiel folgen. Das legt eine Auswertung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) nahe, die in den Jahren 2023 und 2024 Umfragen durchgeführt hat: Mehr als 120 weitere Städte denken demnach ernsthaft über eine kommunale Einweg-Steuer nach. 25 Städte, darunter Bremerhaven, Itzehoe, Saarbrücken und München, sollen eine Einführung bereits prüfen. Andere Städte wie Chemnitz, Eckernförde, Fürth oder Mannheim haben gegenüber der DUH grundsätzliches Interesse an der Steuer bekundet.
Mehr als 45 Kommunen zeigten sich in den Umfragen der DUH noch abwartend: Sie wollten eine Verpackungssteuer davon abhängig machen, wie das Bundesverfassungsgericht über das Tübinger Vorgehen entscheidet.
Durch die Entscheidung wächst das Interesse, erzählt Patzwahl: „Viele Kommunen erkundigen sich aktuell nach unseren Erfahrungen mit der Verpackungssteuer.“ In Zukunft dürfte das Tübinger Modell also Schule machen – und könnte das Essen unterwegs vielerorts verteuern. Tübingen zieht jedenfalls eine positive Bilanz: „Die Steuer wurde sehr schnell akzeptiert. Es gab nur wenig Beschwerden“, sagt Patzwahl.
Verband fordert Aufklärung statt Bürokratie
Kritik kommt dagegen vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga). Dieser lehnt die Steuer vor allem wegen der damit verbundenen Bürokratie ab: Gastronomen müssten vierteljährliche Vorauszahlungen leisten und aufwändige Beleg- und Nachweispflichten erfüllen. Sollten weitere Städte die Verpackungssteuer einführen, drohe außerdem ein „Flickenteppich“ aus unterschiedlichen kommunalen Verpackungssteuer-Satzungen. Das könnte für Betriebe mit mehreren Standorten eine Herausforderung darstellen.Fondsverschmelzung
Auch für Verbraucherinnen und Verbraucher sieht der Dehoga die Belastungsgrenze erreicht: „Die Menschen brauchen keine Teuerungen, sondern müssen beim Thema Mehrweg mitgenommen werden“, sagt Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin des Dehoga Bundesverbandes. „Sie müssen über die Vorteile der Nutzung von Mehrwegbehältern informiert und davon überzeugt werden.“ Mehrwegangebote seiner Mitglieder unterstütze der Verband durch Rahmenvereinbarungen mit entsprechenden Systemanbietern.
Seit Januar 2023 gilt zudem die Mehrwegangebotspflicht: Betriebe müssen für Speisen und Getränke zum sofortigen Verzehr Mehrwegbehälter vorhalten und anbieten. Kleine Betriebe müssen zumindest mitgebrachte Gefäße akzeptieren.






















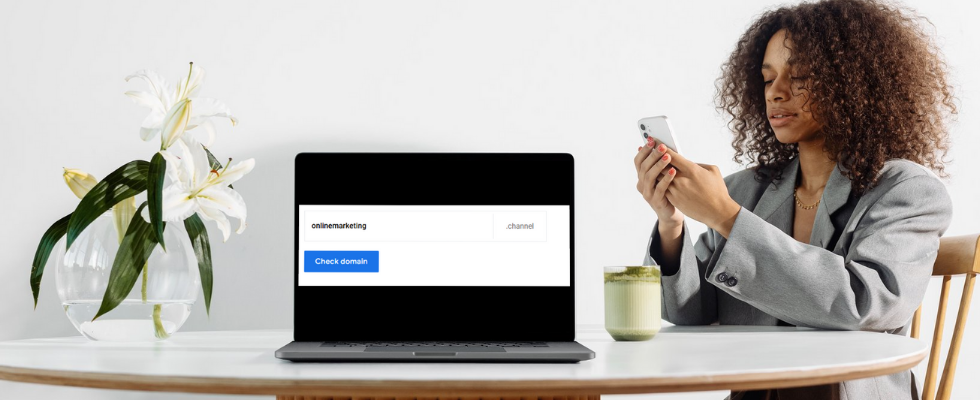
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ee/ff/eeffa375f140fc05a4ae976bc320b3d3/0122830669v1.jpeg?#)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/b4/66/b466fd997c88a351fd1bf512c8732bfc/0122560426v1.jpeg?#)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/79/fe/79fe75dae59bb698825be262783993e4/0122790202v4.jpeg?#)