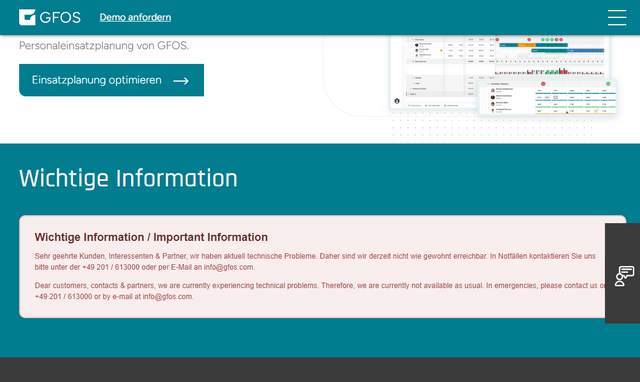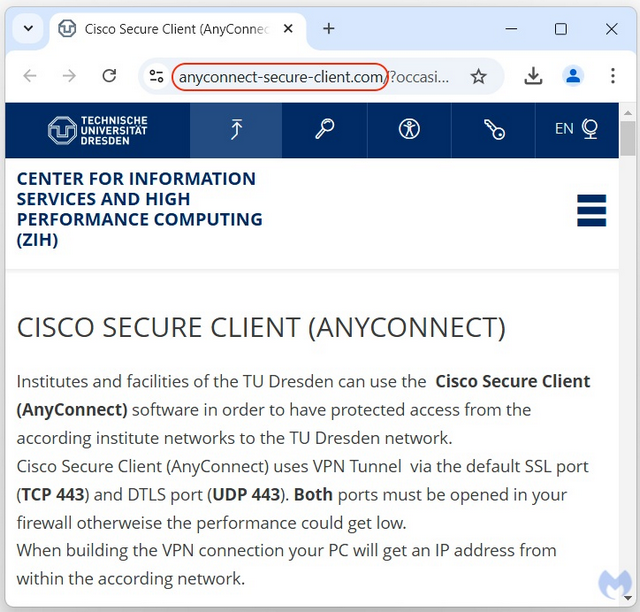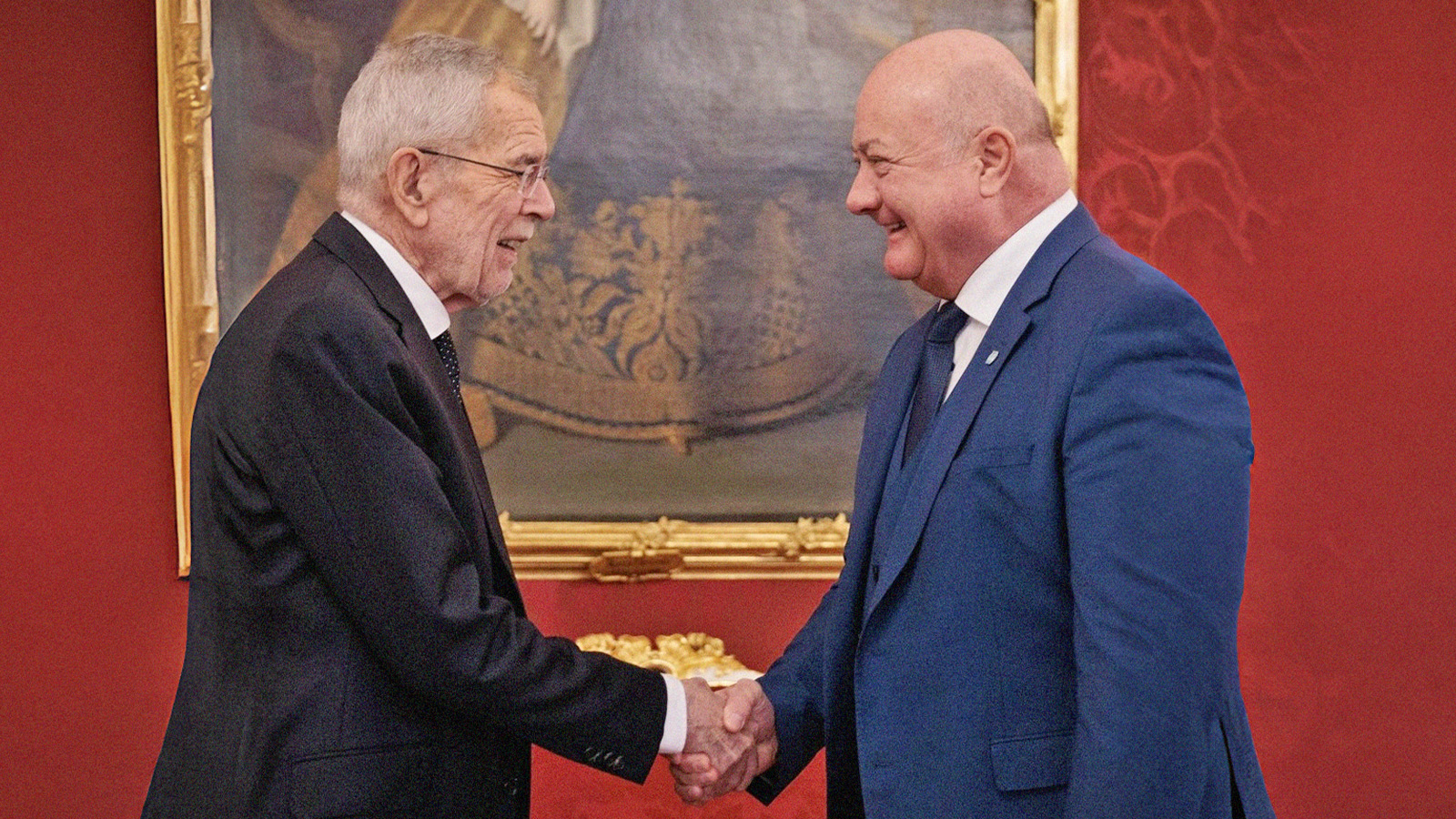Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind ein beliebtes Mittel, um mit Kunden Vertragsbedingungen zu regeln. Einmal aufgesetzt, können Unternehmen sie für eine Vielzahl von Verträgen verwenden. „Es wäre ein enormer Aufwand, wenn man jedes Detail individuell aushandeln müsste“, sagt Kilian Kost, Partner der Kölner Kanzlei WBS.LEGAL und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz.
Wann sind AGB unwirksam?
Für AGB gelten strenge Vorgaben: Eine Reihe von AGB-Klauseln sind gesetzlich verboten und damit unwirksam. Manche der gesetzlichen Vorgaben sind allerdings schwammig formuliert. Daher müssen Gerichte regelmäßig über die Zulässigkeit von bestimmten Klauseln in Allgemeinen Geschäftsbedingungen entscheiden. Zahlreiche AGB-Klauseln wurden im Zuge dessen für unzulässig und damit für unwirksam erklärt.
Welche AGB-Klauseln sind laut Gesetz verboten?
Der Gesetzgeber hat Kriterien entwickelt, welche Klauseln in AGB unwirksam sind. In Allgemeinen Geschäftsbedingungen dürfen demnach keine überraschenden Klauseln stehen. Sie dürfen Kunden auch nicht unangemessen benachteiligen.
Das ist laut Gesetz (Paragraf 307 BGB) etwa der Fall, wenn Bestimmungen nicht klar und verständlich sind. Welche Klauseln verboten und damit unwirksam sind, lesen Sie in unserem Überblick.
Was gilt anstelle der ungültigen AGB-Klausel?
Statt einer unzulässigen AGB-Klausel würden die gesetzlichen Regelungen gelten, wenn es welche gebe, sagt Rechtsanwalt Thomas Repka von der Kanzlei Rose und Partner in Hamburg. Zu manchen Klauseln findet sich allerdings keine entsprechende Regelung, etwa zur Haftungsbegrenzung: „Wenn hier eine AGB-Klausel ungültig ist, haftet das Unternehmen für alles“, warnt der Jurist.
33 verbotene Klauseln in AGB: ein Überblick
Mahngebühren
Sind Kunden mit einer Zahlung in Verzug, können Unternehmen Mahngebühren erheben. Das Bürgerliche Gesetzbuch (§ 309 Nr. 5a BGB) schreibt jedoch vor, dass pauschal keine Gebühren verlangt werden dürfen, die höher sind als der zu erwartende Schaden.
In vielen Urteilen haben Gerichte pauschale Mahngebühren bereits für zu hoch und damit für unwirksam erklärt. Das Oberlandesgericht München (Az.: 29 U 634/11) untersagte eine AGB-Klausel, die eine Mahngebühr von 5 Euro vorsah. Das Oberlandesgericht Düsseldorf (Az.: I-6 U 84/13) kippte eine Klausel eines Mobilfunkanbieters mit einer Mahngebühr von 9 Euro. Selbst eine Mahngebühr von 3 Euro hielten Richter für zu hoch (LG Düsseldorf, Az.: 12 O 374/15).
Die Folge: „Ist die Höhe der Mahngebühr unzulässig, kann das Unternehmen gar keine Mahngebühr verlangen“, sagt Rechtsanwalt Thomas Repka.
In welcher Höhe Unternehmen pauschale Mahnkosten ansetzen können, hängt laut Rechtsprechung vom Einzelfall und den tatsächlich durchschnittlich anfallenden Kosten ab (OLG Hamburg, Az.: 10 U 24/13). Wird die Mahnung per Post verschickt, könnten Firmen lediglich Mahngebühren in Höhe der Kosten für Briefmarke, Druck und Papier berechnen. Nicht gestattet ist es, Personal- oder Verwaltungskosten auf die Mahngebühren umzulegen. Das Oberlandesgericht München (Az.: 29 U 634/11) beispielsweise erklärte im zuvor genannten Fall eine Mahngebühr von lediglich rund 1,20 Euro für zulässig.
Eine einheitliche Rechtsprechung, in welcher Höhe Mahngebühren erlaubt sind, gibt es laut Repka nicht. Akzeptiert werde jedoch meist ein Betrag von bis zu 2,50 Euro. Teilweise würden Gerichte inzwischen aber sogar nur noch Portokosten und Materialkosten in Höhe von etwa einem Euro für zulässig erachten, sagt Repka.
Laut Rechtsanwalt Kilian Kost dürfen Mahngebühren außerdem nur dann festgelegt werden, wenn dem Vertragspartner in den AGB die Möglichkeit eingeräumt wird nachzuweisen, dass der tatsächliche Schaden höher oder niedriger war. Dieser Zusatz sollte also nicht fehlen.
Mehr zum Thema
Außenstände eintreiben
Was tun, wenn Kunden nicht zahlen?
Reklamationen
Unter Geschäftspartnern (B2B) sind AGB-Klauseln erlaubt, die vorschreiben, dass Kunden Mängel innerhalb einer bestimmten Frist reklamieren müssen. Gegenüber Privatkunden sei das jedoch verboten, sagt Repka.
Unzulässig wurden von Gerichten bereits Sätze wie diese erklärt:
„Sollten gelieferte Artikel offensichtliche Mängel- oder Herstellungsfehler aufweisen, wozu auch Transportschäden gehören, so reklamieren Sie bitte solche Fehler sofort gegenüber uns oder dem Mitarbeiter von …, der die Artikel anliefert.“
„Fehllieferungen oder offensichtliche Mängel sind durch den Kunden innerhalb von 2 Wochen nach Anlieferung der Ware zu rügen.“
„Soweit die Transportverpackung bei Warenübergabe und die darin enthaltenen Artikel offensichtliche Beschädigungen zeigen, hat der Käufer gegenüber Firma … binnen 5 Werktagen zu rügen. Anderenfalls können Ansprüche des Käufers hinsichtlich der Beschädigung unter Berücksichtigung von Treu und Glauben abgelehnt werden.“
„Mängel müssen unverzüglich, spätestens aber nach 8 Tagen schriftlich gerügt werden.“
„Sollte doch einmal etwas Grund zur Beanstandung geben, bitten wir um Mitteilung innerhalb einer Woche nach Erhalt der Ware. Spätere Reklamationen können nicht angenommen werden.“
Mehr zum Thema
Erfolgreiches Beschwerdemanagement
4 Schritte zum perfekten Umgang mit Beschwerden
Zurücksenden von Waren
Auch Vorgaben in den AGB zur Rücksendung von Waren können unzulässig sein. Folgenden Satz hatte beispielsweise das Oberlandesgericht Hamm (Az.: 11 U 102/04) für rechtswidrig erklärt: „Wichtiger Hinweis: Bitte senden Sie uns die Ware in der Originalverpackung zurück, legen Sie den beigefügten Rücksendeschein ausgefüllt dazu und verwenden Sie für die Rücksendung den Retourenaufkleber.“
Der Grund: Verbraucher könnten diesen Satz nicht als höfliche Bitte verstehen, sondern als zwingende Voraussetzung für einen wirksamen Widerruf, sagt Rechtsanwalt Jens Leiers von der Kanzlei Muenster Legal in Münster. „Das ist irreführend und kann abgemahnt werden.“ Schließlich dürfe der Verbraucher seinen Widerruf beispielsweise auch telefonisch erklären und die Waren anschließend auch ohne den beigefügten Rücksendeschein zurückschicken.
Selbst wenn die Klausel bloß als Bitte formuliert ist, sei sie unwirksam (OLG Hamm, 10.12.2004, Az.: 11 U 102/04).
Ebenso unzulässig ist es, wenn ein Unternehmen dem Vertragspartner die Rücksendekosten beim Widerruf auferlegt – zumindest, wenn diese eine bestimmte Höhe überschreiten: Bei Preisen von über 40 Euro müssten die Unternehmen die Kosten tragen, sagt Kost. Kunden müssten das Porto auch nicht vorstrecken, sondern dürften die Ware auch unfrei zurückschicken (OLG Hamburg, 24.1.2008, Az.: 3 W 7/08). Unfrei bedeutet, dass der Empfänger die Versandkosten bei Erhalt der Sendung bezahlt.
Rückerstatten des Kaufpreises
Hat der Kunde den Widerruf erklärt, muss ihm der bereits gezahlte Kaufpreis zurückerstattet werden. Es sei jedoch nicht zulässig, in den AGB zu regeln, dass die Rückerstattung nur per Gutschrift auf das Kundenkonto erfolgt, sagt Rechtsanwalt Kost. Eine solche Regelung benachteiligt nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH, Az.: VIII ZR 382/04) den Kunden unangemessen.
Lieferzeiten
Auch unverbindliche Lieferzeiten in AGB sind verboten. Das Oberlandesgericht Frankfurt (Az.: 1 U 127/05) erklärte beispielsweise diese Klausel für unzulässig: „Die Lieferzeit ergibt sich aus dem elektronischen Katalog. Angaben über die Lieferfristen sind unverbindlich, soweit nicht ausnahmsweise der Liefertermin verbindlich und schriftlich zugesagt wurde.“
Das Oberlandesgericht Hamm (Az.: 4 U 167/08) sah die Formulierung „Lieferzeit auf Nachfrage“ als unzulässig an.
Auch schwammige Angaben zur Versanddauer in AGB können rechtswidrig sein, etwa diese Formulierung: „Voraussichtliche Versanddauer: 1-3 Werktage“ (OLG Bremen, Az.: 2 U 49/12).
Hingegen hat das Oberlandesgericht Hamm unter anderem entschieden, dass die Werbung eines Online-Shops mit einer Lieferzeit von „i. d. R. 48 Stunden“ nicht irreführend sei, weil man nie exakt sagen könne, wie lange die Post braucht (OLG Hamm, Az. 4 U 57/21).
Bestellbestätigung im Online-Shop
Das Landgericht München (Az.: 33 O 4638/21) erklärte eine AGB-Klausel eines Onlinehändlers für rechtswidrig, in der stand, dass die Annahme einer Bestellung entweder durch das Versenden einer Versandbestätigung oder durch den Versand der Ware innerhalb von fünf Werktagen nach Eingang der Bestellung erfolgt. Das Nichtversenden einer Bestellbestätigung verstoße jedoch unter anderem gegen die verbraucherschützende Vorschrift des Paragrafen 312i Abs. 1 S. 1 Nr. 3 BGB, sagt Repka. Diese Klausel sei damit rechtswidrig und unwirksam.
Kosten für eine Ersatz-BankCard und -Pin
Der Bundesgerichtshof erklärte am 5. Februar 2025 eine Klausel einer Bank für unwirksam, nach der der Kunde die Kosten für eine Ersatz-Bankcard und -Pin gegebenenfalls tragen sollte. Nach dem Urteil der höchsten Richter verstieß die Klausel gegen das Transparenzgebot nach § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB. Der Verbraucher habe nicht hinreichend erkennen erkennen können, in welchen Fällen die Bank zur Ausstellung einer Ersatzkarte beziehungsweise einer Ersatz-PIN verpflichtet gewesen wäre und in welchen Fällen der Kunde das Entgelt von 12 Euro beziehungsweise 5 Euro hätte zahlen müssen, erklärten die Richter.
Insbesondere fehlten in der Klausel Ausführungen über typische Fälle, in denen der Verbraucher die Kosten für eine Ersatzkarte bzw. eine Ersatz-PIN tragen müsse (Verlust, Diebstahl und Missbrauch).
In den AGB stand lediglich:
„- Ersatzkarte²8 12,00 EUR
– Ersatz-PIN²8 auf Wunsch des Kunden 5,00 EUR
[…]
²8 Wird nur berechnet, wenn der Kunde die Umstände, die zum Ersatz der Karte/PIN geführt haben, zu vertreten hat und die Bank nicht zur Ausstellung einer Ersatzkarte/Ersatz-PIN verpflichtet ist.“
Verwahrentgelt (Negativzinsen)
In der Niedrigzinsphase erhoben einige Banken „Negativzinsen“ (oder auch: „Sollzinsen“). Eine Bank berechnete für höhere Guthaben auf Girokonten ein solches Verwahrentgelt und benutzte dafür folgende AGB-Klausel:
„3.2Entgelt für die Verwahrung von Einlagen
Girokonten […] – Verträge ab 01.08.2020¹6
Einlagen bis 25.000,00 EURO 0,00 % p.a.
Einlagen über¹7 25.000,00 EURO 0,50 % p.a.“
[…] Die Berechnung erfolgt taggenau. Die Belastung der Gebühr erfolgt monatlich nachträglich zulasten des jeweiligen Kontos.
[…] ¹6 Für Verträge mit Abschlussdatum vor dem 01.08.2020 erfolgt die Bepreisung ab Unterzeichnung der individuellen Zusatzvereinbarung.
¹7 Bepreisung erfolgt auf den übersteigenden Betrag.“
Der Bundesgerichtshof (BGH) entschied, dass mit dem Verwahrentgelt eine Hauptleistung aus dem Girovertrag bepreist werde und dieser Vorgang bei Girokonten grundsätzlich rechtens sei. Allerdings sei die Klausel intransparent und deshalb unwirksam. Die Klauseln informierten laut dem Urteil der Richter nicht hinreichend genau darüber, auf welches Guthaben sich das Verwahrentgelt in Höhe von von 0,5% p.a. bezog (Az.: XI ZR 161/23). Unklar sei dabei vor allem gewesen, ob die Berechnung des Verwahrentgelts taggenau erfolgen sollte und bis zu welchem Zeitpunkt Tagesumsätze auf den Girokonten bei der Berechnung des maßgebenden Guthabensaldos berücksichtigt werden sollten.
Die Richter erklärten zudem Klauseln für unwirksam, die Verwahrentgelte für Tagesgeld- und Sparkonten vorsehen. „Mit der Erhebung eines Verwahrentgelts in Höhe von 0,5% p.a. verlieren die Tagesgeldkonten gänzlich ihren Spar- und Anlagezweck“, schrieben die Richter in der Urteilsbegründung. Zweck von Spareinlagen sei es, das Vermögen mittel- bis langfristig aufzubauen und durch Zinsen vor Inflation zu schützen. Die Erhebung des Verwahrentgelts reduziere die auf die Sparverträge eingezahlten Spareinlagen, was von dem Vertragszweck „Kapitalerhalt und Sparen“ abweicht. Dies stelle eine unangemessene Benachteiligung der Verbraucher dar.
Gewährleistung
Vorsicht ist laut Kost auch bei vermeintlich gesetzlich erlaubten Gewährleistungsbeschränkungen geboten. So sei es nach Paragraf 476 Abs. 2 BGB zwar bei gebrauchten Sachen durchaus zulässig, die Gewährleistung auf ein Jahr zu beschränken. Der Bundesgerichtshof (BGH, Az.: II ZR 340/14) erklärte die Formulierung „Bei gebrauchten Artikeln gilt eine Gewährleistung von einem Jahr“ dennoch für unwirksam. Durch diese Formulierung der AGB würde auch die Haftung für grob fahrlässig oder gar vorsätzlich begangene Pflichtverletzungen erleichtert, sagt Kost. Das sei jedoch nach Paragraf 309 Nr. 7b BGB verboten.
Laut Rechtsanwalt Thomas Repka muss deshalb immer zwingend folgender Zusatz dabeistehen: „Ausgenommen sind vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden.“
Außerdem ist es gemäß Paragraf 309 Nr. 8 b BGB unzulässig, die Mangelrechte pauschal auszuschließen, sofern der Vertragspartner nicht unverzüglich den Mangel rügt. Ein solcher Ausschluss sei nur in Bezug auf offensichtliche Mängel zulässig, sagt Kost.
Ebenso unzulässig ist nach einem Urteil des OLG Hamm ein Verbot, Gewährleistungsansprüche aufgrund von Mängeln abzutreten (Az. I-4 U 99/14). Gerade bei Kaufsachen, die weiterveräußert werden, wäre es eine unzumutbare Benachteiligung, wenn nur der Erstkäufer Gewährleistungsansprüche geltend machen könnte, sagt Kost. Das betrifft zum Beispiel Einzelhändler, die Ware von einem Sportartikelhersteller beziehen und diese weiterverkaufen.
Haftung
Sich mit AGB-Klauseln vor Haftungsrisiken zu schützen, ist sinnvoll und wichtig, etwa für Bauunternehmen und Handwerker. In vielen AGB befinden sich daher Klauseln, die Haftungsfragen regeln. Dabei lauern jedoch Fallen, die für Unternehmen fatale Folgen haben können. Wenn ein Handwerker beispielsweise einen Schaden am Haus eines Kunden verursacht, könne dies schnell zu sehr hohen Schadenersatzforderungen führen, sagt Rechtsanwalt Repka. „Wenn die AGB-Klausel unzulässig ist, haftet das Unternehmen für alles.“
Haftungseinschränkungen sind nur in einem sehr engen Rahmen zulässig. Verboten sind nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (Paragraf 309 Nr. 7 BGB) Klauseln, die eine Haftung für die Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit in irgendeiner Weise einschränken.
Auch Klauseln, in denen der Hinweis fehlt, dass eine Haftungsbeschränkung für die Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit ausgenommen ist, können nach Paragraf 309 BGB unwirksam sein. Aus diesem Grund erklärte der Bundesgerichtshof folgende Klausel für unzulässig: „In jedem Fall bleibt aber eine Verjährungsfrist von einem Jahr erhalten.“ (Az.: III ZR 263/20). Eine Klausel, welche sich nach dem Wortlaut der AGB auf Sachmängel bezieht, stelle ohne diesen Zusatz (auch) eine zeitliche Haftungsbegrenzung für andere Schäden dar, zum Beispiel für die Verletzung des Lebens, Körpers sowie der Gesundheit und sei damit rechtswidrig. „Die Verjährungsverkürzung ist dann unwirksam und es gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen“, sagt Repka.
Auch eine Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit darf in den Geschäftsbedingungen nicht ausgeschlossen oder begrenzt werden. Nicht erlaubt ist also ein Satz wie dieser: „Wir haften nicht für Schäden aufgrund vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung.“
Zulässig sind dagegen Haftungseinschränkungen für Schäden, die durch leichte Fahrlässigkeit entstehen. Um leichte Fahrlässigkeit handelt es sich, wenn ein Fehler trotz sorgfältigem Vorgehen gelegentlich passieren kann. Doch selbst dann müssen Unternehmen aufpassen: Damit die AGB-Klausel wirksam sei, müsse immer zwingend als Zusatz dabeistehen: „Diese Beschränkung gilt nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit.“ „Wenn das nicht drin ist, ist die gesamte Klausel zur Haftungsbegrenzung unwirksam“, sagt Repka.
Mehr zum Thema
Beispielfälle für Haftungsrisiken
Wer zahlt, wenn Mitarbeitern ein teurer Fehler passiert
Gefahrübergang
Gerade im Handwerk ist die Frage von großer Bedeutung, wann der sogenannte Gefahrübergang stattfindet – also wann das Risiko, dass eine Sache beschädigt oder vernichtet wird, vom Unternehmen auf den Kunden übergeht.
„Solange ein Handwerker beispielsweise das von ihm gebaute Gartenhaus noch nicht übergeben hat, trägt er das Risiko, dass es aus irgendeinem Grund beschädigt oder vernichtet wird, beispielsweise wenn der Blitz darin einschlägt“, sagt Repka. „Dann muss er es wieder aufbauen.“
Oftmals werde in AGB versucht, diesen Moment des Gefahrübergangs vorzuverlagern. Bei einem Werkvertrag dürfe der Gefahrübergang laut Gesetz jedoch immer erst mit der Abnahme stattfinden. Werkverträge werden typischerweise im Handwerk geschlossen, beispielsweise auf dem Bau. Ein Werkvertrag liegt nach Paragraf 631 BGB vor, wenn sich ein Unternehmen zur Herstellung eines bestimmten Werks verpflichtet – also beispielsweise den Bau eines Gartenhauses – und dafür vom Auftraggeber bezahlt wird.
Unzulässig sei auch diese Klausel: „Unabhängig von der Gefahrtragung hafte ich nicht für den Untergang des Werks durch einen Blitzeinschlag.“
Gerichtsstand
Falls es zum Rechtsstreit kommt, ist laut Zivilprozessordnung bei einem Privatkunden immer das Gericht zuständig, an dem dieser seinen Wohnsitz hat. Einen anderen Ort (Gerichtsstand) in den AGB zu vereinbaren sei nicht erlaubt, sagt Repka.
Bei Geschäftskunden ist das anders: Im B2B-Bereich dürfen Unternehmen beispielsweise grundsätzlich in den AGB regeln, dass das Gericht am Ort des Anbieters zuständig ist.
Aufrechnen von Forderungen
Unzulässig ist eine AGB-Klausel wie diese: „Der Kunde darf Forderungen gegen uns nur insoweit aufrechnen, als seine Forderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.“
Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs (BGH, Az.: XI ZR 309/16) benachteilige diese Klausel Verbraucher unangemessen, sagt Rechtsanwältin Hanna Schmidt von der Kanzlei Oppenhoff & Partner in Köln. Der Verbraucher werde dadurch – beispielsweise nach einer Widerruferklärung – in der Rückabwicklung eines Vertrages unzulässig beschränkt, weil er Forderungen eben nur dann aufrechnen dürfe, wenn sie unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
Schmidt empfiehlt daher, einen Zusatz in die AGB-Klausel aufzunehmen: „Der Kunde darf Forderungen gegen uns nur insoweit aufrechnen, als seine Forderungen unbestritten, rechtskräftig oder zumindest entscheidungsreif festgestellt sind oder es sich um Gegenforderungen aus demselben Vertragsverhältnis handelt (dies schließt auch Rückzahlungsansprüche nach Ausübung des Verbraucherwiderrufsrechts mit ein).“
Schriftform
Beliebt und standardmäßig in fast allen AGB zu finden ist Schmidt zufolge eine einfache oder doppelte Schriftformklausel.
Einfache Schriftformklausel: „Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.“
Doppelte Schriftformklausel: „Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für den Verzicht auf das Schriftformerfordernis.“
Seit 2016 gilt jedoch für Verträge mit Verbrauchern, die seit dem 1. Oktober 2016 geschlossen werden: Schriftformklauseln – egal ob in der einfachen oder doppelten Variante – sind rechtswidrig, sagt Schmidt. Sie empfiehlt, derartige Klauseln aus AGB zu entfernen.
Das ist insbesondere bei Kündigungen wichtig. „In der Form, wie man ein Geschäft abgeschlossen hat, muss man es auch kündigen können“, sagt Rechtsanwalt Repka. Unternehmen dürften Privatkunden also nicht vorschreiben, ein online abgeschlossenes Abo nur schriftlich zu kündigen, sondern das müsse auch beispielsweise per E-Mail oder Online-Formular möglich sein.
Laut Paragraf 309 Nr. 13 lit. b BGB darf ein Unternehmen – außer in Fällen, in denen das Gesetz notarielle Beurkundung vorschreibt – für Erklärungen wie etwa eine Kündigung keine strengere Form als die Textform vorschreiben. Textform bedeutet im Sinne des Paragrafen 126b BGB, dass eine Person eine Erklärung auch mittels E-Mail oder einem Online-Formular abgegeben kann.
Im Geschäftsverkehr zwischen Kaufleuten kann eine solche Klausel laut Rechtsanwalt Kilian Kost dagegen Bestand haben. (BGH, Az.: I ZR 43/07)
Salvatorische Klauseln
Standardmäßig in vielen AGB steht laut Schmidt auch eine Klausel wie diese: „Sollte eine der Bestimmungen dieser AGB unwirksam oder undurchführbar sein, berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung ist durch eine wirksame und durchführbare zu ersetzen, die den mit der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung verfolgten Regelungszielen am nächsten kommt. Gleiches gilt bei etwaigen Vertragslücken.“
Das Oberlandesgericht Frankfurt (Az.: 6 W 55/11) erklärte so eine Klausel für unwirksam. Diese sogenannte salvatorische Klausel mache es dem Vertragspartner praktisch unmöglich, bei Vertragsschluss zuverlässig zu wissen, welche Regelung nun gilt, sagt Schmidt.
Auch von einer AGB-Klausel wie dieser rät die Rechtsanwältin ab: „Sollte eine der Bestimmungen dieser AGB unwirksam oder undurchführbar sein, berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht.“ Sie sei überflüssig, weil sie einfach die gesetzliche Regelung (Paragraf 306 Abs. 1 BGB) wiedergebe.
Unternehmer sollten auf salvatorische Klauseln in AGB gänzlich verzichten, empfiehlt Schmidt. „Sie bringen keinen Mehrwert, stellen aber ein unnötiges Risiko dar, weil sie abgemahnt werden können. Es ist daher erstaunlich, dass sie immer noch in vielen AGB zu finden sind.“
Zustimmungsfiktion bei AGB-Änderung
Viele AGB zu Geschäftsmodellen, die auf ein Dauerschuldverhältnis ausgelegt sind – das ist beispielsweise eine Versicherung oder ein Netflix-Abo –, enthalten eine sogenannte Zustimmungsfiktionsklausel. Eine solche Klausel sieht typischerweise vor, dass ein Unternehmen beabsichtigte AGB-Änderungen dem Kunden spätestens zu einem vorher definierten Zeitpunkt vor dem Inkrafttreten der Änderungen in Textform anbietet. Die Zustimmung des Kunden soll als erteilt gelten, wenn er den Änderungen nicht bis zum Wirksamwerden der Änderungen widerspricht – vorausgesetzt der Unternehmer hat den Kunden mit der Mitteilung über die beabsichtigten Änderungen auf diese Genehmigungswirkung hingewiesen. Ist der Kunde mit den vorgeschlagenen Änderungen nicht einverstanden, kann er die vertragliche Beziehung durch Kündigung gegenüber dem Unternehmer beenden.
Diese bisherige Praxis sei spätestens seit dem Urteil des Bundegerichtshofs (BGH) vom 27.04.2021 (Az. XI ZR 26/20) – bestätigt durch ein Urteil vom 19.11.2024 (Az. XI ZR 139/23) – sehr problematisch, sagt Schmidt. Darin entschied der BGH, dass eine solche Klausel in den AGB von Banken gegenüber Verbrauchern unzulässig ist. Dies gilt insbesondere, wenn sie die Grundlagen der rechtlichen Beziehungen der Parteien umgestalten und zu einer erheblichen Verschiebung des Verhältnisses von Leistung und Gegenleistung zugunsten des Unternehmens führen können, das die AGB verwendet.
Für die Praxis – auch in Branchen jenseits des Bankensektors – bedeutet dies, dass Firmen AGB mit entsprechenden Zustimmungsfiktionen überarbeiten müssen. Eine Zustimmungsfiktion ist nur noch in engen Grenzen möglich. Insbesondere für wesentliche Änderungen der AGB, die dem Abschluss eines neuen Vertrages gleichkommen können, müssen Unternehmen die ausdrückliche Zustimmung des Kunden einholen.
Im aktuellen Fall vor dem BGH enthielt die AGB-Klausel einer Sparkasse eine Regelung, wonach die Zustimmung des Kunden zu angebotenen Änderungen von Vertragsbedingungen oder Entgelten für Bankleistungen als erteilt gilt, wenn der Kunde der Beklagten seine Ablehnung nicht innerhalb einer bestimmten Frist anzeigt. Diese Klausel sei jedoch unwirksam, urteilten die Richter am Bundesgerichtshof am 19.11.2024. Die Sparkasse muss dem Kläger nun seine Kontoführungsentgelte und Gebühren für eine Girokarte für mehrere Jahre zurückzahlen.
Was kann bei verbotenen AGB-Klauseln passieren?
Viele Kunden, insbesondere Verbraucher, akzeptieren zunächst die AGB, oft ohne sie tatsächlich im Detail gelesen zu haben. Das bedeutet aber nicht, dass diese Bedingungen auch wirksam sind. Regelmäßig klagen Kunden und Verbraucherschützer gegen AGB-Klauseln vor Gericht. Verbraucherschutz-Verbände, aber auch Wettbewerber und Wettbewerbsvereine wie die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs haben stets ein wachsames Auge auf AGB und mahnen Unternehmen rege ab, die unzulässige Klauseln verwenden. „Wenn auch nur ein Teil einer Klausel unwirksam ist, wird möglicherweise die ganze Klausel unwirksam“, sagt Rechtsanwalt Thomas Repka.
Bereits kleinste Fehler können reichen, damit Wettbewerber oder Verbraucherschützer eine Abmahnung aussprechen können. Im Prinzip könne jede unzulässige Klausel abgemahnt werden: „Man muss nur begründen können, dass dadurch eine Täuschung oder Benachteiligung von Verbrauchern stattfindet”, sagt Repka. Und das sei bei unwirksamen AGB-Klauseln meist der Fall.
Eine Abmahnung ist in der Regel mit einer Unterlassungserklärung verbunden. Wer die unterschreibt, verpflichtet sich ein Leben lang, den Verstoß nicht noch einmal zu begehen – und falls doch, eine Vertragsstrafe zu zahlen.
Für Verstöße gegen eine Unterlassungserklärung sind häufig Vertragsstrafen von 3000 Euro bis 5000 Euro vorgesehen. Diese können sich jedoch schnell vervielfachen, wenn der Verstoß mehrmals begangen wird, beispielsweise, wenn ein Unternehmen mehrere Artikel in einem Onlineshop mit denselben AGB verkauft hat. Auch viele Jahre später drohen noch Vertragsstrafen aus einer unterschriebenen Unterlassungserklärung.
The post Diese 33 Klauseln in AGB sind verboten appeared first on impulse.