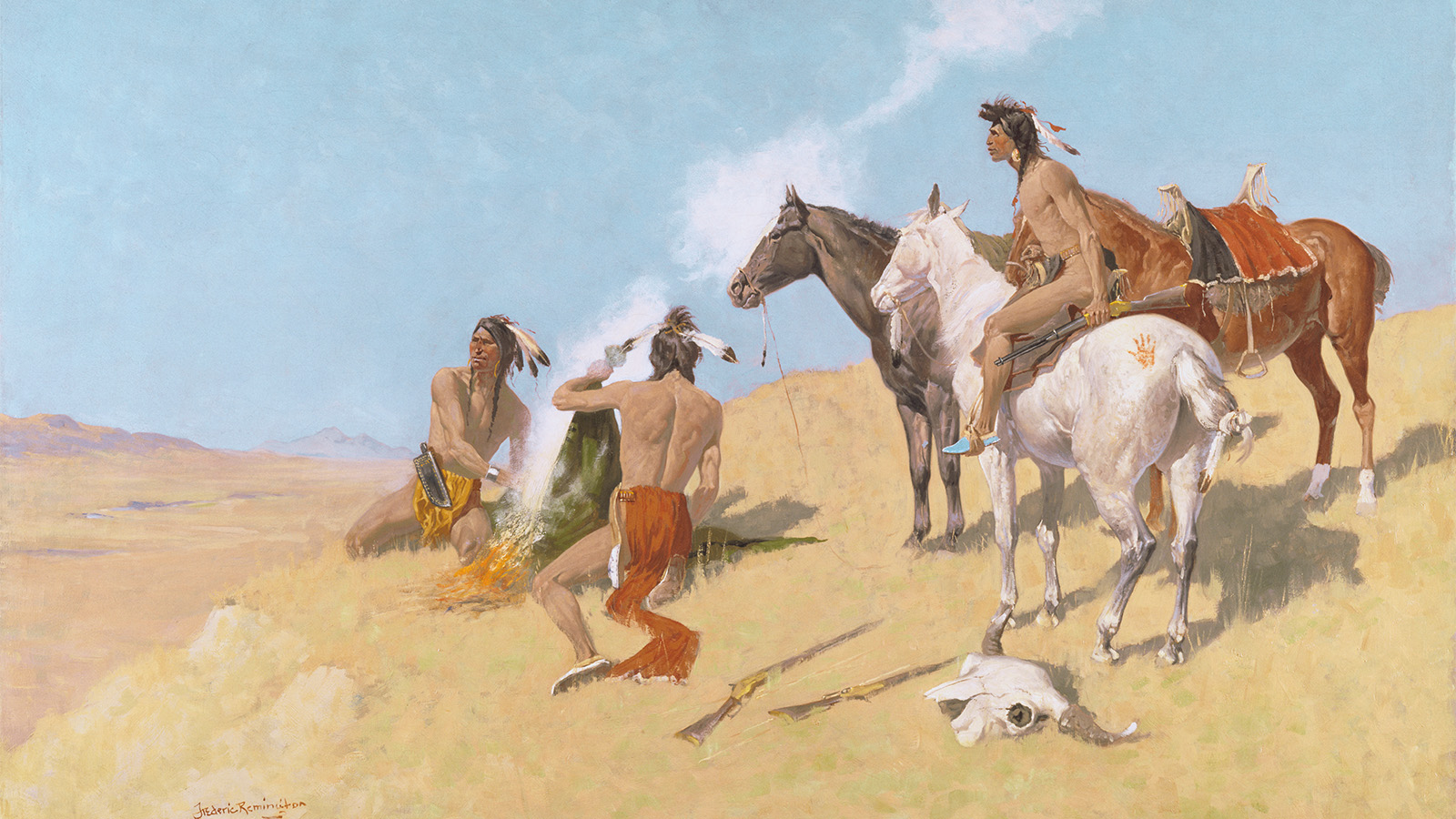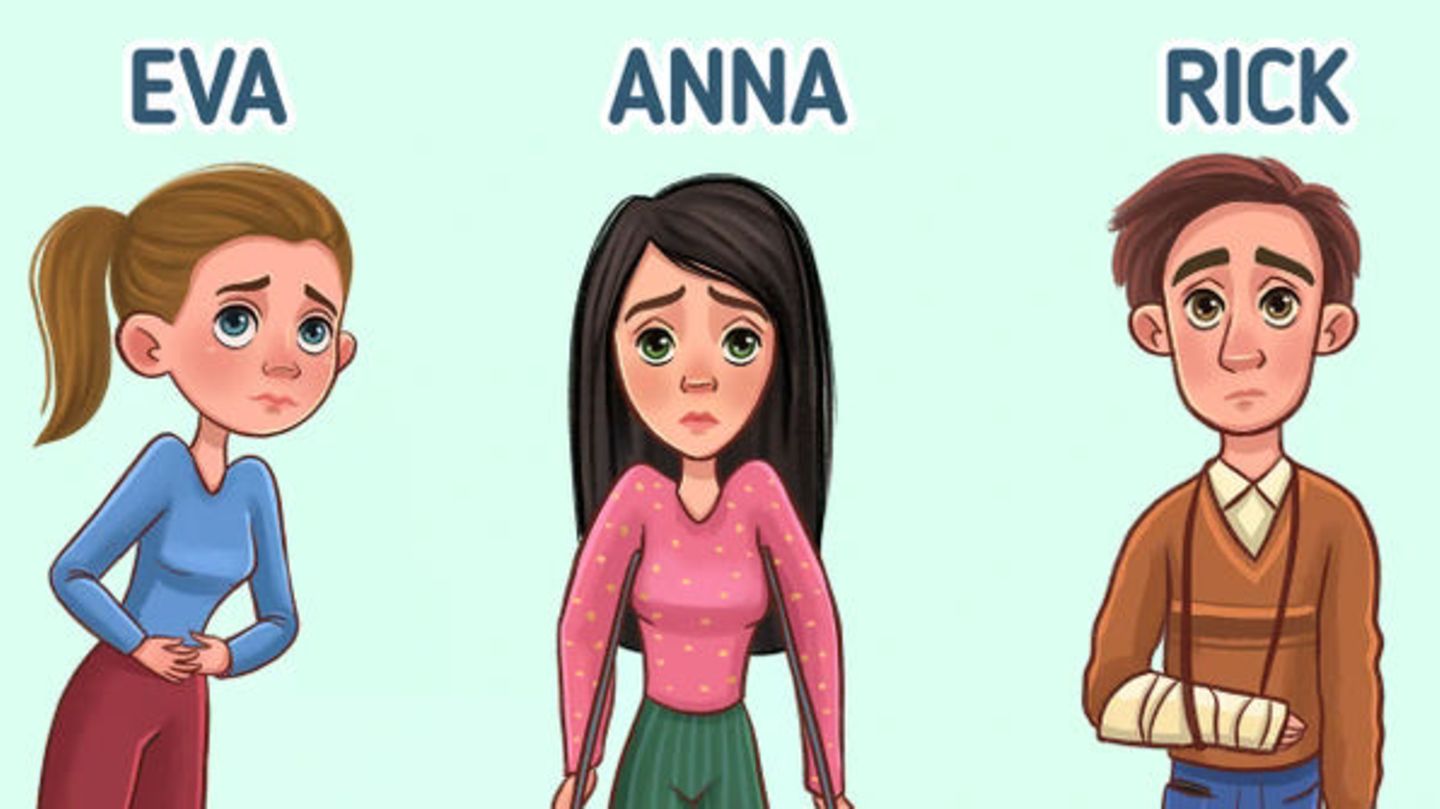Wie männlich muss Mann in Zukunft sein?
Schon Herbert Grönemeyer stellte sich die Frage aller Fragen: „Wann ist ein Mann ein Mann“? Früher waren die Voraussetzungen klar. Der Mann hatte Geld zu verdienen, seine Familie zu ernähren und sich möglichst „männlich“ zu verhalten. In einer moderner werdenden Gesellschaft rückt dieser Begriff „Männlichkeit“ aber mehr und mehr in ein anderes Licht. Was viele […] Der Beitrag Wie männlich muss Mann in Zukunft sein? erschien zuerst auf Gentleman-Blog.

Schon Herbert Grönemeyer stellte sich die Frage aller Fragen: „Wann ist ein Mann ein Mann“? Früher waren die Voraussetzungen klar. Der Mann hatte Geld zu verdienen, seine Familie zu ernähren und sich möglichst „männlich“ zu verhalten. In einer moderner werdenden Gesellschaft rückt dieser Begriff „Männlichkeit“ aber mehr und mehr in ein anderes Licht. Was viele Menschen als solches definieren, ist heute gar nicht mehr so zutreffend. der Gentleman-Blog geht der Frage nach, wie männlich ein Mann heute und in Zukunft eigentlich sein soll – wohl wissend, dass es unmöglich und auch nicht gewollt ist, hier eine Aussage für alle Männer zu treffen.
Eine zentrale Frage ist dabei auch, ob „Männlichkeit“ ein erstrebenswerter Zustand oder der passende Begriff ist, oder ob dieser nicht viel eher durch „Menschlichkeit“ ersetzt werden sollte. Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, ob es nicht auch völlig normal ist, dass manche Berufe und Branchen eher bei Männern auf Interesse stoßen und auch das ein oder andere Hobby bei Frauen kaum Anklang findet.
Hier gilt es zu differenzieren zwischen biologischen Attributen, gesellschaftlich gelebten Rollenbildern und Individualität. Spätestens dann wird klar, dass „Männlichkeit“ ein flexibler Begriff ist und sich gar nicht so genau zuordnen lässt. Wir schauen uns an, wie „männlich“ Sie in Zukunft sein müssen und was das überhaupt bedeutet.
Die traditionelle Definition von Männlichkeit
Retrospektiv betrachtet war der Begriff „Männlichkeit“ immer untrennbar mit festen Rollen und klaren Attributen verbunden.
Der Mann galt als:
- Ernährer der Familie
- Beschützer von Frauen und Kindern
- Entscheidungsträger in allen wichtigen Fragen
Diese Definition war (und ist bis heute) so tief in gesellschaftlichen Normen verankert, dass sie von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Werfen Sie einmal einen Blick auf viele ältere Paare, die Ihnen begegnen. Oft leben sie bis heute das frühere Rollenbild in der Praxis aus, obwohl wir tendenziell mehr und mehr davon wegkommen.
Mit dem historischen Blick gesehen war die Rolle des Mannes mit wirtschaftlicher Verantwortung und physischer Stärke verbunden. Es war seine Aufgabe, die Familie materiell abzusichern und sie vor Gefahren zu schützen. Emotionen zu zeigen oder sich um Care-Arbeit zu kümmern galt als unmännlich und schwach, es widersprach dem Bild eines Mannes. Unsicherheit und Verwundbarkeit durften Sie sich als Mann noch vor einigen Jahrzehnten niemals erlauben.
Viele Männer wuchsen mit Sprüchen wie: „Ein Mann weint nicht“ oder „Stell dich nicht so an“ erzogen und damit automatisch in ihr Rollenbild gedrängt. Emotionale Kälte und eine gewisse Härte wurden nicht nur akzeptiert, sondern zelebriert. Männer, die sich anders verhielten, mussten mit Spott, Ablehnung und Häme rechnen.
Solche traditionellen Rollenbilder hatten aber nicht nur Einfluss auf Männer selbst, sondern auch auf die Gesellschaft und das Familienleben. Aufgaben waren strikt getrennt und nach Geschlecht sortiert. Während Sie als Mann für die Ernährung und den Schutz verantwortlich waren, hütete die Frau das Haus. Das einseitige Konzept der Männlichkeit versprach zwar Sicherheit und Stabilität auf der einen Seite, führte aber zu mangelnder Entwicklung von Persönlichkeit und Individualität.
Wie sich das „Mannsein“ im Laufe der Jahre gewandelt hat
In den vergangenen Jahrzehnten unterlag die Gesellschaft einem permanenten Wandel. Auch das Thema „Männlichkeit“ ist heute ein anderes als noch vor 30, 40 oder 50 Jahren. Starre Rollenmuster und klare Erwartungen lösen sich mehr und mehr auf. Stattdessen hat sich (zumindest stellenweise) ein deutlich breites Definitionsfeld ergeben, was einen „Mann“ ausmacht und was nicht.
Das nachfolgende Video aus einer ZDF-Sendung unbubble setzt sich mit der Frage auseinander, was traditionelle und moderne Männlichkeit eigentlich unterscheidet und wieso auch Männer ein Stück Weiblichkeit in sich haben dürfen:
Dieser Wandel ist nicht durch Zufall entstanden. Er ist die Folge von gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Entwicklungen, die früher festgelegte Normen mehr und mehr infrage stellen. Ganz besonders der Feminismus und die zunehmende Akzeptanz von Diversität haben nachhaltige Veränderungen bewirkt und tun es bis heute.
Die Auswirkung des Feminismus auf das typische Männerbild
Denken Sie auch, dass der Feminismus nur die Rolle der Frau verändert hat? Ein großer Irrglaube, denn mit dem Feminismus wurde und wird gleichzeitig auch für die Rechte von Männern gekämpft! Gleichberechtigung impliziert nicht nur, dass Frauen sich Positionen in der Arbeitswelt erarbeiten und ihre Rolle als gleichwertige Persönlichkeiten sicherstellen. Sie steht auch dafür, dass Männer von veralteten Normen abweichen dürfen. Als Mann dürfen Sie heute Hausmann sein, die Rolle des Vollzeitvaters übernehmen und sich auch einmal von Ihrer Partnerin beschützen lassen.
Durch diesen Wandel, der bis heute nicht abgeschlossen ist, wird das Ideal des starken und nicht-emotionalen Ernährers zunehmend aufgelöst. Stattdessen begrüßt die heutige Gesellschaft, dass Sie als Mann Ihre weiche und verletzliche Seite zeigen. Sie dürfen als Mann scheitern und daraus Stärke für Ihre Zukunft ziehen!
Der Feminismus hat auch dazu geführt, toxische Männlichkeitsvorstellungen auf den Prüfstand zu stellen. Themenbereiche wie emotionale Intelligenz, psychische Gesundheit und Empathie haben an Bedeutung gewonnen. Männer, die früher zum „Hartbleiben“ erzogen wurden, lernen heute, dass es eine Stärke ist, eigene Schwächen zu zeigen.
LGBTQIA+ und Diversität in Kombination mit Männlichkeit
Nicht nur der Feminismus hat die Definition von Männlichkeit verändert, sondern auch die zunehmende Sichtbarkeit und Akzeptanz von LGBTQIA+. „Mannsein“ ist heute kein starres Konzept mehr, sondern ein fluides Modell, das verschiedene Identitäten und Lebensrealitäten berücksichtigt.
Sie müssen sich nicht mehr in ein binäres Konzept von „männlich“ und „unmännlich“ einfügen, sondern haben das Recht, Ihr eigenes Selbstbild individuell zu gestalten.
Traditionelle Attribute wie körperliche Stärke oder Dominanz werden immer weniger als Maßstab für Männlichkeit gesehen. Stattdessen sind es nun Eigenschaften wie Respekt, Toleranz, Offenheit und Authentizität, die als positiv-männlich wahrgenommen werden. Die Tatsache, dass Sie heute frei über Ihre sexuelle Orientierung, Ihre Geschlechtsidentität und Ihre Lebenswünsche sprechen können, ist eine Bereicherung für das männliche Selbstbild.
Männlichkeit vs. Menschlichkeit
Wenn sich der starre Druck von außen löst, bleibt die Frage übrig, ob „Männlichkeit“ überhaupt noch ein erstrebenswerter Zustand ist. Oder ist es viel eher an der Zeit, menschliche Werte universeller zu betrachten, ohne sie einem Geschlecht zuzuordnen?
Eigenschaften wie Stärke, Durchsetzungsfähigkeit und Rationalität allein dem Mann zuzuschreiben ist heute jedenfalls nicht mehr zeitgemäß. Dazu reicht ein Blick auf die moderne Frau und ihre Stärken, die sie tagtäglich im Alltag unter Beweis stellt. Frauen leisten nicht nur die gleiche Arbeit wie Männer, sind in Jobs, Politik und Gesellschaft eingebunden, sondern kämpfen darüber hinaus noch immer intensiv gegen alte Vorurteile, Klischees und Stereotype.
Die Idee, Männlichkeit zum Ziel zu machen, ist eindeutig überholt. Vielmehr ist es die Fähigkeit, sich frei von Geschlechterklischees zu entfalten, die wir heute als Gesellschaft erstrebenswert sehen. Ob Sie als Mann sanftmütig oder durchsetzungsstark, emotional oder rational sind, ist Ihre persönliche Entscheidung und nicht das Ergebnis einer gesellschaftlichen Verpflichtung.
Vorurteile gegen „unmännliches“ Verhalten
Trotz des gesellschaftlichen Wandels ist es kein Geheimnis, dass Vorurteile noch immer eine wichtige Rolle spielen. Gerade in älteren Generationen wird es kritisch betrachtet, wenn der Mann von heute von den traditionellen Vorstellungen abweicht.
Wer Gefühle zeigt, wird belächelt und ein Mann, der sich für häusliche Tätigkeiten entscheidet, wird als „Memme“ gesehen. Der Kampf gegen Vorurteile wie diese läuft an breiter Front und gibt auch Ihnen die Chance und die Möglichkeit, Ihre Rolle als Mann nach eigenem Gusto zu entdecken und zu leben. Wenn Sie als Mann gegen veraltete „Normen“ verstoßen, leisten Sie so einen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Verbesserung und beweisen, dass Männlichkeit keinen Verhaltenskodex braucht, sondern Raum für individuelle Entfaltung bietet.
Berufe und Hobbys – was bleibt typisch männlich?
Schauen wir uns den Arbeitsmarkt von früher an, gab es auch hier ganz klare Definitionen. „Männliche“ und „weibliche“ Jobs waren an der Tagesordnung. Gleiches galt und gilt bis heute stellenweise noch für Freizeitbeschäftigungen und Hobbys. Fußball, Motorsport, Glücksspiel, Kampfsport, Schnitzen und andere handwerkliche Tätigkeiten – all das waren in der Vergangenheit fast ausnahmslos Männerhobbys.

Grafik: Typische Hobbys und Berufe von Männern und Frauen
Hier müssen wir stark zwischen Interessen und Verfügbarkeit unterscheiden. Nehmen wir den Themenbereich des Glücksspiels. Bietet eine Online-Spielothek einen Willkommensbonus für Neukunden an, wird dieser statistisch gesehen eher von männlichen Nutzern eingelöst. Das liegt daran, dass das generelle Interesse an Glücksspiel bei Männern höher ist. Umgekehrt heißt es aber nicht, dass diese Form der Freizeitunterhaltung für Frauen nicht geeignet ist. Das ist der große Unterschied zwischen „damals“ und „heute“.
Frauen dürfen heute (selbstverständlich!) Fußballspielen und haben die Möglichkeit, sich in der Spielbank aufzuhalten, handwerklich tätig zu werden und ein „männliches“ Hobby auszuüben. Dass sie es durchschnittlich seltener tun, hat wiederum nur teilweise mit biologischen Aspekten, aber viel auch viel mit gelerntem und anerzogenem Sozialverhalten sowie mit ihren Interessen zu tun.
Ähnlich sieht es im Berufsfeld aus. Technische und körperlich belastende Berufe waren früher fast ausnahmslos Männern vorbehalten, stehen heute aber beiden Geschlechtern frei. Dennoch gibt es immer noch mehr männliche Handwerker als weibliche und weniger männliches Pflegepersonal als weibliches.
Beispiel: Im Jahr 2024 waren in Hoch- und Tiefbauberufen 2,2 % Frauen und 97,8 % Männer beschäftigt. In hauswirtschaftlichen und erzieherischen Berufen waren es hingegen 83,8 % Frauen und nur 16,2 % Männer.
Schauen wir uns doch einmal typische Berufe und Hobbys an, die bis heute noch immer bestimmten Geschlechtern zugeordnet werden.
Teilweise korrelieren hier Interessen mit Vorurteilen und gesellschaftlichen Herausforderungen. So ist der Mann, der sich für eine Ausbildung oder ein Studium im pädagogischen Bereich entscheidet, bis heute ein Exot. Gleiches gilt für medizinische Fachangestellte, die nur in den seltensten Fällen männlich sind. Wurde Ihre Krankenkassenkarte jemals von einem männlichen Angestellten eingelesen?
Es erfordert Mut, sich hier den geschlechtsspezifischen Mustern zu widersetzen und die Ausbildungszeit womöglich als einziger Mann in einer Berufsschulklasse mit Frauen zu bestehen. Aber je offener die Gesellschaft auch hier wird, desto vielfältiger wird der Beruf für beide Seiten.
Die biologische Komponente der Männlichkeit
Seit Jahren wird darüber diskutiert, ob Attribute von Männlichkeit und Weiblichkeit ausnahmslos sozial geprägt sind oder wieweit auch biologische Komponenten eine Rolle spielen. Weitgehend klat scheint, dass Biologie und Soziologie ineinander übergreifen, doch wie groß ist der hormonelle Einfluss und wie viel wird von der Gesellschaft vorgegeben?
Eine Hauptrolle spielt das männliche Sexualhormon Testosteron, allerdings wird seine Wirkung oft missverstanden. Zunächst einmal ist dieses Hormon nicht „rein männlich“, sondern auch bei Frauen vorhanden. Der Unterschied entsteht durch die Konzentration – sie ist bei Männern durchschnittlich höher.
Das erkennen Sie ganz klar an optischen Anzeichen, denn Testosteron sorgt für:
- Stimmvertiefung
- Bartwuchs und Körperbehaarung
- Muskelwachstum
- Risikobereitschaft
Testosteron ist aber weder ein Freibrief für toxische Männlichkeit noch eine universelle Erklärung für „männliches“ Verhalten. Kulturelle und soziale Faktoren haben einen mindestens ebenso großen Einfluss.
Beispiel: Das Vorhandensein von Testosteron erhöht das Bedürfnis nach Anerkennung und Status, insbesondere durch das weibliche Geschlecht. Soziale und kulturelle Faktoren beeinflussen allerdings, wie sich das Streben nach diesen Zielen äußert.
Es ist ein Mythos, dass Testosteron einen Mann zwangsläufig aggressiver macht und sie zu „unsozialen“ Handlungen treibt. Aggression entsteht nicht allein auf Basis von Hormonen, sondern im Zusammenspiel zwischen eigener Persönlichkeit, Umwelt und Rechtsempfinden.

Biologische Unterschiede zwischen Frauen und Männern
Auch wenn es einige Frauen nicht gern hören, gibt es zwischen den beiden Geschlechtern ganz klare biologische Unterschiede, die im Einzelfall natürlich unterschiedlich stark ausgeprägt sein können. Männer reagieren tendenziell stärker auf Wettbewerb und hierarchische Strukturen, Frauen hingegen suchen oft gezielter nach sozialen Bindungen.
Diese Unterschiede nun rein auf die Biologie zurückzuführen, wäre falsch. Unser menschliches Gehirn ist anpassungsfähig und die kulturelle Prägung hat großen Einfluss auf die Entwicklung von Interessen und Verhaltensweisen.
Hier ist das räumliche Denkvermögen ein Paradebeispiel, bei dem der Mann im Durchschnitt bessere Ergebnisse erzielt als die Frau. Oft wurde der Fakt rein biologisch abgehandelt, doch das steht mehr und mehr infrage. Diese scheinbar biologischen Unterschiede lassen sich durch Übung und Erfahrung klar beeinflussen.
Nicht viel anders verhält es sich mit vermeintlich „männliche“ und „weiblichen“ Verhaltensweisen. Als Mischung von biologischen Anlagen und sozialer Konditionierung sind Menschen und insbesondere Männer auch hier „lernfähig“.
Wenn die Natur durch Normen beeinflusst wird
Fangen Sie damit an, „Männlichkeit“ rein biologisch zu definieren, greift dieser Ansatz zu kurz. Hormone und genetische Anlagen sind eine wichtige Grundlage, die sich kaum beeinflussen lässt. Die soziale Prägung aber ist es, die letztlich die Definition von „Männlichkeit“ festlegt. In unserer Gesellschaft wurden (und werden) Jungen und Mädchen von klein auf unterschiedlich behandelt. Das fängt bei Spielzeugen an und endet bei Sprache und Erwartungen an die Entwicklung.
Das wiederum führt zur Verstärkung von Verhaltensmustern, die wir oft als „natürlich“ ansehen. Diese Dinge später zu hinterfragen fällt schwer, denn es war ja „normal“. Ohne pauschalisieren zu wollen, fällt auf, dass ältere Generationen größere Schwierigkeiten mit Veränderungen dieser klassischen Vorurteile haben als jüngere.
Sie wuchsen mit strengen Rollenvorgaben auf und oft fehlt das Verständnis dafür, dass es heute anders gehen kann. Ein Blick in die Diskussionskultur sozialer Netzwerke wie TikTok, Threads und Co. belegt das schnell. Immer häufiger fällt nicht nur der Begriff „Geschlechterkonflikt“, sondern auch „Generationenkonflikt“.
Typische Erziehungsmuster, die die Entstehung von Unterschieden und vermeintlichen Normen fördern, sind:
- Erwartungshaltung: Jungen wird oft vermittelt, dass sie mutig und kämpferisch sein müssen. Mädchen hingegen werden auf Hilfsbereitschaft und Anpassungsfähigkeit konditioniert.
- Kleidung: Farben und Designs von Kinderkleidung verstärken das stereotype Rollenbild. Blau für Jungen und Rosa für Mädchen sind Klassiker.
- Spielzeuge: Im Jungenzimmer finden sich Autos, Werkzeuge, Bauklötze und Kreativspielzeuge, während bei Mädchen Puppen, Küchenutensilien oder Handarbeitsmaterialien zu finden sind. Das prägt Interessen und insbesondere auch Kompetenzen.
- Freizeitgestaltung: Jungs werden eher zu körperlich aktiven Hobbys wie Karate und Fußball ermutigt, während Mädchen sich in Mal- und Musikkursen wiederfinden.
Über Jahrzehnte hinweg galten diese Normen als normal und wurden nicht oder nur vereinzelt hinterfragt. Für ein Kind der 1980er wäre es in den meisten Fällen undenkbar gewesen, als Junge mit Barbie zu spielen oder feminine Kleidung in der Schule zu tragen. Und auch wenn die Bereitschaft zur „geschlechtsneutralen“ und offenen Erziehung heute deutlich häufiger zu finden ist, scheitern diese Ansätze auch heute noch oft am breiten Widerstand gesellschaftlicher Gruppen.
Einerseits sind Gleichstellung und Fortschritt gewünscht, andererseits gibt es aber die große Angst, mit den Traditionen auch die Identität zu verlieren, und das ist gerade unter Männern verbreitet.
Ist moderne Männlichkeit ohne Druck möglich?
Die Gesellschaft vollzieht einen permanenten Wandel. Was „damals“ noch normal war, gilt heute als überholt und antiquiert. Mit der Bereitschaft, offener zu werden und Menschen unabhängig vom Geschlecht Entfaltungsspielraum zu geben, kommen auch neue Herausforderungen auf Männer und Frauen zu. Gerade für den Mann fühlt es sich stellenweise so an, als werde er seiner Identität beraubt.
Geboren als „Ernährer, Beschützer, Erfinder und Entwickler“ trifft er heute auf eine Gesellschaft von Frauen, die selbstständig, eigenständig und gleichgestellt sind. Jetzt heißt es also, eine neue Identität zu entwickeln und „Männlichkeit“ nicht mehr mit der Einhaltung von Rollenbildern zu definieren. Aber wie finden Sie als Mann hier noch einen Platz, ohne sich plötzlich unmännlich zu fühlen?
Männlichkeit unter Druck: Die Erwartungen von Frauen, Männern und der Gesellschaft
In gewisser Weise hatte der Mann der 1930er dem heutigen Mann etwas voraus. Er wusste (scheinbar), was seine Aufgaben im Leben waren. Wirklich positiv ist diese Tatsache aber nicht. Selbst wenn sie seinerzeit etwas anders hätten machen wollen, hatte ein Großteil der Männer keine andere Wahl. Mit ihrer Geburt wurde ein Großteil ihrer Lebenslinien gezeichnet und sie hatten die Erwartungen zu erfüllen, die die Gesellschaft an sie stellte.
Und heute? Funktioniert „Männlichkeit“ heute erwartungslos? Keineswegs, die Herausforderungen haben sich allerdings geändert.
Beispiel: Früher forderten Ehefrauen einen starken, solventen Partner, der sich um Ernährung, Finanzen und Schutz kümmerte. Emotionen und Schwächen waren in einer solchen Partnerschaft oftmals kaum ein Thema, der Mann war der starke Part. Heute fordern Frauen berechtigterweise Gleichberechtigung und mehr Sensibilität von ihrem Partner, während einige Männer (auch durch erzieherische Prägung) noch an klassischen Männlichkeitsbildern festhalten. Hier sind Konflikte vorprogrammiert.
Noch mehr Druck entsteht durch die Gesellschaft. Sie erwartet, dass moderne Männer flexibel, empathisch und emotional zugänglich, gleichzeitig aber auch erfolgreich und selbstbewusst sind. Dieser Druck, alles gleichzeitig zu sein, ist nicht selten überwältigend bis überfordernd.

Freiheit oder Krise?
Zur Welt zu kommen, ohne einen vorbestimmten Weg nach gesellschaftlichen Normen, kann befreiend wirken. Für nachfolgende Generationen wird sich die Art und Weise, wie sie „Männlichkeit“ definieren, deutlich verändern. Schwieriger ist es für jene Männer, die noch nach alten Traditionen aufgewachsen sind und sich heute dem Wandel gegenüber sehen. Ist „der neue Mann“ nun ein Stück Freiheit oder führt er zur Identitätskrise?
Verunsicherung kann dazu führen, dass manche Männer auf extremere Formen der „Männlichkeit“ zurückgreifen, traditionelle Werte überhöhen und mit aller Macht gegen den Verlust kämpfen. Andere suchen nach Orientierung in neuen Rollen, fühlen sich aber ohne leitende Vorbilder. Das führt zu einer flächendeckenden Unsicherheit, wie Männlichkeit in der modernen Welt definiert und gelebt werden kann.
Die entscheidende Frage: Wie “typisch-männlich” wollen Sie sein?
Jetzt stehen Sie hier, mit all den Informationen über Männlichkeit und stellen sich immer noch die Frage, die einst auch Grönemeyer umtrieb. „Wann ist ein Mann ein Mann“? Bei der Beantwortung dieser Frage können wir nun mit Chromosomenlehre anfangen oder uns darauf fokussieren, was die Gesellschaft von „männlichem“ Verhalten erwartet. Zunächst einmal nichts, was sie nicht auch von einer Frau erwarten würde.
Als Mann haben Sie heute deutlich mehr Entfaltungsmöglichkeiten, da Sie frei von traditionellen Konventionen und einengenden Männlichkeitsvorstellungen leben dürfen. Ihre Sexualität, Ihre Identität, Ihre Persönlichkeit – all das ist nicht mehr an die feste Vorstellung des emotionslosen Ernährers mit Muskelkraft gebunden.
Diese neue Freiheit kann Angst machen, da sie zu einer Art Identitätsverlust führt. Wenn es plötzlich keine klaren Definitionen mehr fürs „Mannsein“ gibt, wonach richtet sich dann das eigene Verhalten? Ganz klare Antwort: Nach der Menschlichkeit!
„Können“ statt „müssen“
Es ist kein Tabu mehr, wenn ein Mann gern seine Fingernägel lackiert und offen über seine Emotionen spricht. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch keine Pflicht, so zu agieren. Nicht viel anders sieht es bei Frauen aus. Sie haben heute grundsätzlich die Möglichkeit, sich beruflich und privat frei zu entwickeln. Das Lebensmodell der traditionellen Hausfrau und Mutter ist deswegen aber noch lange kein Tabu. Der größte Unterschied des Wandels besteht eigentlich darin, dass aus „Muss“ ein „Kann“ geworden ist.
Sie verlieren Ihre Männlichkeit nicht, wenn Sie die Kinder betreuen, sich für „feminine“ Hobbys interessieren oder nicht der Familienernährer sein möchten. Sie dürfen aber auch weiterhin der selbstbewusste Fußballliebhaber und Alleinverdiener sein, wenn das Ihre Vorstellung von Ihrem idealen Leben ist. Genau das zeichnet Sie als Mann aus – zu sein, wie Sie sich fühlen, ohne sich dabei strengen Konventionen und Vorgaben zu unterwerfen.
Bilder: K. I. / deposithphotos.com
Der Beitrag Wie männlich muss Mann in Zukunft sein? erschien zuerst auf Gentleman-Blog.